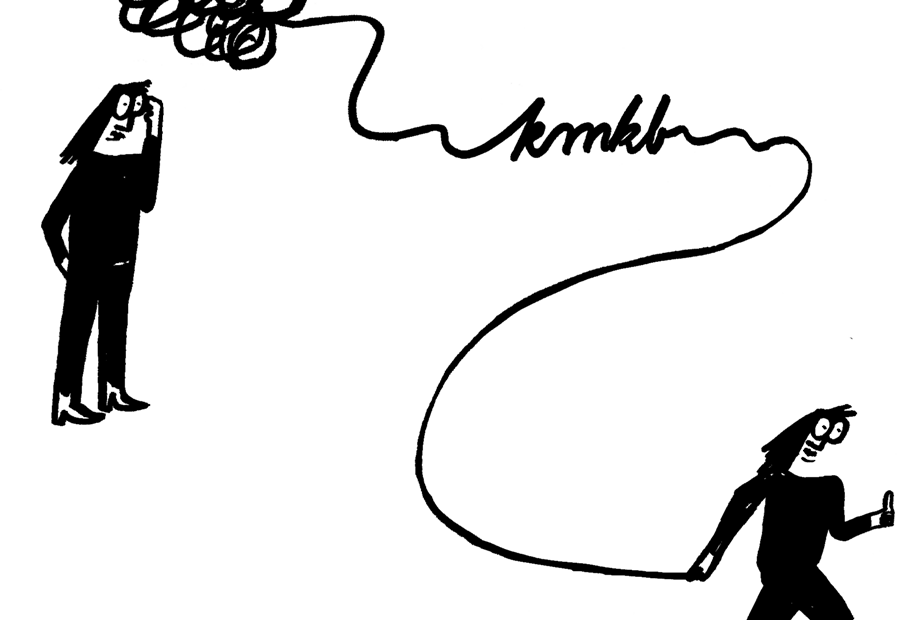Was bedeutet Kunstfreiheit?
Kunstfreiheit bezeichnet das Grundrecht, Kunst frei von staatlicher Kontrolle, Zensur und anderen Einschränkungen zu schaffen, auszustellen und zu verbreiten.
- Was bedeutet Kunstfreiheit?
- Seit wann gibt es die Kunstfreiheit?
- 1. Definition der Kunstfreiheit im Weimarer Verfassungstext
- 2. Definition der Kunstfreiheit in der nationalsozialistischen Gesetzgebung (1933-1945)
- 3. Deutsches Grundgesetz,Artikel 5 Absatz 3 (24. Mai 1949)
- Die Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Kunstfreiheit
- Lesetip: Kunstfreiheit – Zehn Jahre Debatten in Politik & Kultur
Seit wann gibt es die Kunstfreiheit?
Schon vor 1949, als das Konzept der Kunstfreiheit in das Grundgesetz aufgenommen wurde, wurde sie gesetzlich erstmalig in der Weimarer Reichsverfassung (WRV) 1919 festgelegt. Diese erste gesetzliche Festlegung durch die Verfassungsversammlung war die Grundlage für die spätere Aufnahme in das Grundgesetzt.
Zwischen der Weimarer Reichsverfassung und dem Grundgesetz gab es Jahre, während deren die Kunstfreiheit massiv eingeschränkt wurde, bzw. abgeschafft war. Zwar gab es keinen offiziellen Akt, der die Weimarer Verfassung vollständig außer Kraft setzte, aber unter Adolf Hitlers nationalsozialistischer Regierung etablierten die Nazis durch eine Reihe repressiver Gesetze und Maßnahmen eine totalitäre Diktatur, die verfassungsmäßige Rechte und Freiheiten effektiv aushebelte.
Künstler*-, Kultur- und Medienschaffende wurden Repressionen ausgesetzt, massiv verfolgt und vor Gericht gebracht. In dieser Zeit entstand der Begriff der “Entarteten Kunst“. Kunst musste dem Volke, wie es die Nazis verstanden, dienen. Wenn dem nicht entsprochen wurde, wurde man aus der jeweiligen Kammer, die der Reichskulturkammer untergeordnet war ausgeschlossen. Der Künstler* wurde an den Pranger gestellt, öffentlich diffamiert oder kam in ein Arbeits-, bzw. Konzentrationslager. Hunderttausende von Künstlern* und Kulturschaffenden, die nicht dem Diktat entsprechen wollten, emigrierten nach Großbritannien, Dänemark, Norwegen, Frankreich, weiter in die USA, oder eines der Länder, die noch nicht von der Herrschaft der Nazis betroffen waren. Einher, mit der Flucht (Reichsfluchtsteuer) gingen Zwangsverkäufe des Besitzes und die Beschlagnahmung von Kunstgegenständen.
Umso mehr erkannte man 1949 die Bedeutung der Freiheit von Kunst und Wissenschaft im Rahmen der Definition des Grundgesetztes für eine demokratische und liberale Gesellschaft an.
1. Definition der Kunstfreiheit im Weimarer Verfassungstext
Am 31. Juli 1919 wurde die Weimarer Verfassung verabschiedet (gültig vom 14. August bis 31. August 1933).
Die Kunstfreiheit war in der Weimarer Reichsverfassung in Artikel 142 festgelegt:
“Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.”
Die Weimarer Verfassung wurde durch ein breites Spektrum an politischen Akteuren* geprägt, die von sozialistischen bis konservativen Ideen reichten. Führende Persönlichkeiten wie Friedrich Ebert, Hugo Preuß (Innenminister, verantwortlich für den Erstentwurf), Philipp Scheidemann und Matthias Erzberger hatten den größten Einfluss auf die Inhalte der Verfassung und ihre demokratische Ausrichtung. Die Vielfalt der an der Verfassung beteiligten Parteien (28 Ausschussmitglieder) spiegelte die unterschiedlichen gesellschaftlichen Strömungen und den Willen wider, Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg und dem Sturz der Monarchie in eine parlamentarische Demokratie zu transformieren. Viele der Verfassungsartikel entstammten der Paulskirchenverfassung (Beschluss der Grundrechte des Deutschen Volks) von 1849. Einige stammten aus modernen Verfassungen anderer Staaten und andere waren ganz neu.
Die Weimarer Verfassung wurde innerhalb Deutschlands sehr kritisch betrachtet. Die umliegenden Länder wiederum, in Ost- und Mitteleuropa, aber auch in Südamerika, die sich in Gründung befanden, orientierten sich daran. Die wurde von ihnen als die modernste und fortschrittlichste Verfassung angesehen.
Lernen Sie die Weimarer Verfassung kennen
(interaktives Lernmodul – Haus der Weimarer Republik – hdwr.de)
2. Definition der Kunstfreiheit in der nationalsozialistischen Gesetzgebung (1933-1945)
Die Gesetzgebung der nationalsozialistischen Regierung hub sukzessive die freiheitliche Gesetzgebung der Weimarer Reichsverfassung auf.
2.1. Reichstagsbrandverordnung (28. Februar 1933)
Diese Notverordnung setzte wesentliche Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft, darunter die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und Schutz vor willkürlicher Festnahme. Die Verordnung eröffnete der Polizei weitreichende Befugnisse zur Verfolgung politischer Gegner und legte den Grundstein für die Unterdrückung künstlerischer und wissenschaftlicher Freiheit. Sie war ein zentrales Instrument, um jegliche oppositionelle oder unliebsame kulturelle Betätigung zu unterdrücken, auch in Kunst und Wissenschaft.
2.2. Ermächtigungsgesetz (24. März 1933)
Das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“, bekannt als Ermächtigungsgesetz, gab der Regierung das Recht, Gesetze ohne Zustimmung des Reichstags und ohne Rücksicht auf die Verfassung zu erlassen. Damit konnten die Nationalsozialisten rechtliche Strukturen und Inhalte der Verfassung, einschließlich der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, ungehindert umgehen und außer Kraft setzen.
Durch das Ermächtigungsgesetz konnte die NS-Regierung fortan jedes Gesetz verabschieden, das den künstlerischen und wissenschaftlichen Ausdruck kontrollierte und zensierte.
2.3. Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (7. April 1933)
Mit diesem Gesetz wurden Beamte* und Angestellte im öffentlichen Dienst entlassen, wenn sie „nicht arischer Abstammung“ waren oder politische Gegner des Regimes waren. Dies betraf auch viele Wissenschaftler*, Künstler* und Professoren*, die aus ihren Positionen an Universitäten und Kulturinstitutionen verdrängt wurden.
Diese Maßnahme führte zu einer umfassenden Säuberung und Gleichschaltung von Bildung und Kultur. Zahlreiche Künstler* und Wissenschaftler* emigrierten, um der Verfolgung zu entgehen.
Kunst im Nationalsozialismus (wikipedia)
3. Deutsches Grundgesetz,
Artikel 5 Absatz 3 (24. Mai 1949)
“Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.”
Die Kunstfreiheit in Deutschland umfasst verschiedene wesentliche Merkmale:
Die Kunstfreiheit schützt nicht nur das künstlerische Werk (z.B. Bilder, Musik, Literatur), sondern auch den kreativen Prozess. Das bedeutet, dass Künstler sich ohne staatliche Eingriffe entfalten und ihre Kunst erschaffen können, ohne zensiert oder eingeschränkt zu werden.
Weite Interpretation des Kunstbegriffs
Der Begriff »Kunst« wird in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts weit ausgelegt. Nicht nur klassische Kunstformen wie Malerei oder Musik fallen darunter, sondern auch moderne und experimentelle Kunstformen. Grundsätzlich wird alles, was als künstlerischer Ausdruck angesehen wird, durch Art. 5 Abs. 3 GG geschützt.
Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe
Die Kunstfreiheit ist ein sogenanntes Abwehrrecht gegen den Staat. Das bedeutet, dass der Staat nicht das Recht hat, die Kunst zu kontrollieren oder zu zensieren. Jeglicher Eingriff in die künstlerische Freiheit bedarf einer besonders strengen Rechtfertigung und kann nur in sehr begrenzten Fällen erfolgen (z. B. bei Volksverhetzung oder in anderen Fällen, in denen die Rechte Dritter betroffen sind).
Zusammenhang mit Meinungsfreiheit und Pressefreiheit
Die Kunstfreiheit steht in engem Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) und der Pressefreiheit. Kunst kann ein Mittel sein, um Meinungen auszudrücken und gesellschaftliche oder politische Kritik zu äußern. Auch dies ist durch die Verfassung geschützt.
Schutz vor Verbot und Zensur
Grundsätzlich dürfen staatliche Behörden Kunstwerke nicht verbieten oder zensieren. In Ausnahmefällen – etwa bei rechtswidrigen Inhalten – kann jedoch eine Grenze der Kunstfreiheit erreicht sein. Eine gerichtliche Überprüfung solcher Maßnahmen ist jedoch in jedem Fall notwendig, um den hohen Schutzstandard zu gewährleisten.
Freiheit der künstlerischen Ausbildung
Auch die Freiheit der künstlerischen Ausbildung ist geschützt, sodass Institutionen wie Kunsthochschulen und -akademien in ihren Lehrmethoden und Inhalten weitgehend frei sind. Dies unterstützt die Entwicklung einer vielfältigen Kunstszene und ermöglicht eine freie künstlerische Bildung.
Die Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Kunstfreiheit
Was Kunst ist, bestimmt der Diskurs der Kunst selbst. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat einige Abgrenzungskriterien entwickelt, die aber keineswegs als abgeschlossen gelten können. Kunst sei Ausdruck schöpferischen Gestaltens, mit dem Erlebnisse, Eindrücke und Meinungen zum Ausdruck gebracht werden. Mittel des Ausdrucks sei eine Formensprache, die Eindrücke usw. zur unmittelbaren Anschauung bringe. Damit ist nicht viel gewonnen. Diese Begriffsbestimmung bietet eher Orientierungspunkte, um im Einzelfall zu entscheiden, ob es sich um Kunst handelt. Immerhin lässt sich sagen, dass der Begriff eher weit zu verstehen ist. Kunst kann nur beschränkt (Schranken) werden, wenn andere Grundrechte ihr entgegenstehen, wie z. B. das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Auch mit dem Mittel der Kunst darf man nicht zu Körperverletzungen aufrufen.
Quelle: Das Rechtslexikon. Begriffe, Grundlagen, Zusammenhänge. Lennart Alexy / Andreas Fisahn / Susanne Hähnchen / Tobias Mushoff / Uwe Trepte. Verlag J.H.W. Dietz Nachf. , Bonn, 2. Auflage, 2023. Lizenzausgabe: Bundeszentrale für politische Bildung.
Lesetip:
Kunstfreiheit – Zehn Jahre Debatten in Politik & Kultur

Der Kulturrat bringt mit diesem Buch, welches von Olaf Zimmermann und Theo Geißler herausgegeben wurde, eine umfassende Rückschau auf 10 Jahre Debatte um dem Begriff der Kunstfreiheit.
Dabei werden aus unterschiedlichen Perspektiven von 107 Autoren* die unterschiedlichen Dimensionen, wie z.B. die Kunstfreiheit und Recht, Jugendschutz, oder den Bedrohungen von links und rechts thematisiert.
Das Buch gibt Einblick, in den Wert bundesdeutscher Debattenkultur um das verbriefte Recht der Kunstfreiheit.
Kunstfreiheit – Zehn Jahre Debatten in Politik & Kultur
- Herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler
- Redaktion Gabriele Schulz
- 320 Seiten, ISBN-13 978-3-947308-64-4
- Blick ins Buch (mit Inhaltsverzeichnis)